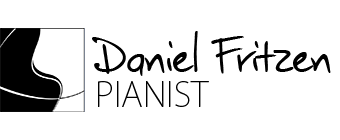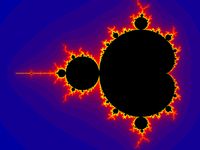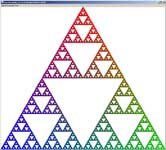Mehr als nur graue Theorie
Abschluss: Doctor of Musical Arts (UCLA)
Dissertation betreut von Prof. Susan McClary und Robert Winter
Konzertexamen bei Vitaly Margulis
Die Musik von damals, erklärt für heute
“Es fasziniert mich, Biografien von Komponist:innen zu lesen und sie als Menschen kennenzulernen.” Davon erzählt der Pianist gezielt seinem Publikum, damit sich die Leute in der Musik selbst wiederfinden können. “Das holt die Musik vom akademischen Sockel und macht sie zutiefst menschlich.” In seinen Moderationen schafft Daniel Fritzen gezielt Berührungspunkte, die beim Hören als roter Faden dienen, um mit Vorstellungsbildern bereichert tiefer in das Hörerlebnis einzutauchen.
Themenkonzerte
Programme sind bereits zu den Themen Wald, Meer, Heimat und Frieden entstanden. Statt Frieden diplomatisch zu vermitteln, lässt uns Musik Frieden innerlich fühlen. Liszts 2. Ballade versöhnt sich am Ende mit allen durchlebten Krisen und verwandelt die Melodie des Haderns in eine erlöste, glückliche Form. In der Klaviersonate op. 111 lässt Beethoven am Ende des Kopfsatzes zum ersten Mal das Kämpfen los, das ohnmächtige Anrennen gegen das Schicksal und sinkt in den tiefen Frieden des zweiten Satzes.
“Heimat” kann viele Bedeutungen haben. Für den Aspekt der seelischen Identität spielt Daniel Fritzen Mazurkas von Chopin. Die folkloristischen Anklänge polnischer Tänze waren für den in Paris lebenden Chopin zum Sinnbild seiner Heimatssehnsucht und seelischen Identifikation geworden, fast als wäre das Heimatflair eine Geliebte. Als Polen erneut zwischen Russen und Preußen aufgeteilt wurde, nahmen die eigenwilligen Rhythmen bei Chopin auch den Tonfall von verletztem und sich auflehnendem Stolz an – kein Nationalismus, sondern kulturelle Identifikation.
Als drittes Beispiel sei hier ein Programm mit Naturthemen kurz angeschnitten. Unter allen Klavierstücken über den Wald ist Liszts “Waldesrauschen” besonders. Bei R. Schumanns “Waldszenen” geht es um den Jäger, das Wirtshaus, die Herberge, also um die zivilisatorischen Klischees des Menschen im Wald. Nicht anders ist es bei McDowells “Waldidyllen”. Bei Liszt geht es um den Wald selber und um seinen Zauber. Wenn der Wald Wald um seiner selbst willen sein darf, hat er für Menschen den kostbarsten Erholungswert.
Moderations-Beispiele
Grieg: Lyrische Stücke I
Die Musik von Grieg hat etwas tief Naturverbundenes. Es sind nicht nur die Stücke, die im Namen auf Natur anspielen, wie “Bächlein”, “An den Frühling”, “Waldesstille”, oder an die Waldbewohner wie Elfen, Feen und Trolle, die es ja in Norwegen wirklich gibt [hier entsteht meist verhaltenes bis herzliches Gelächter]. Sondern es sind auch die unzähligen Volkstänze und Volkslieder. Darin lebt für mich das Gefühl, Feste in der Natur zu tanzen – ein Astrid-Lindgren-Gefühl, barfuß auf der Wiese zu tanzen.
Grieg scheint damit auch den Zauber einer vergangenen Zeit zu beschwören und auch ein bisschen zu verklären, ähnlich wie Robert Schumann den “Fröhlichen Landmann” verklärt, dessen Leben als Bauer ja wahrlich kein einfaches war. Trotzdem klingt es in der Natursehnsucht der Musik wie ein verlorenes Paradies. Deshalb zitiere ich nicht umsonst den Astrid-Lindgren-Vergleich, denn auch die erklärte Erinnerungen an die Kindheit haben etwas von verlorenem Zauber. Es gibt ja die entwicklungspsychologische Deutung des “Rauswurfs aus dem Paradies”, die in der Erinnerung an das Paradies die verlorene kindliche Unbefangenheit sieht. Als wir zu denken und zu reflektieren begannen, verloren wir diesen paradiesischen Zustand der Unbekümmertheit.
Natürlich wollen wir als Erwachsene nicht mehr in die Kindheit zurück, und als moderner Mensch wollen wir auch nicht in die rustikale Lebensweise zurück, die in der Musik und der Poesie immer wieder als verlorenes Paradies, das es so nie gegeben hat, beschwört wird. Aber wenn uns kindliche Unbekümmertheit und Naturnähe vollkommen abhanden kommen, wird unser Leben sehr freudlos und frustriert. Ich glaube, deshalb haben Komponisten wie Grieg den seelisch gesunden Aspekt der naturverbundenen, rustikalen Lebensweise, die wir evolutionär schon überwunden haben, als musikalische Perlen bewahrt, so dass wir unser Gemüt immer wieder dafür öffnen können, um irgendwie heilere, ganzheitlichere Menschen zu bleiben.
Grieg: Lyrische Stücke II
In diesem zweiten Teil meiner zyklischen Gesamtaufführung aller Lyrischen Stücke von Edward Grieg habe ich das Bedürfnis, den Kontrast einer Beethoven-Sonate dagegen zu setzen und damit die Stücke in einen kulturgeschichtlichen Werdegang zu setzen. Das heutige Leitthema ist das “ich” – also das Selbstverständnis des Menschen im Wandel der Zeit. Die “Klassiker” wie Beethoven haben wie vorhin gehört, im Sinne der Aufklärung das Selbstbewusstsein des individuellen “ichs” behauptet, gestärkt und zuletzt sogar wieder transzendiert.
Nach dieser “Vorarbeit” wurde im folgenden Jahrhundert, der romantischen Epoche, eine tiefere Instanz des Selbst entdeckt: Das fühlende Gemüt und die Seele. Es ist ein eigentümliches Phänomen in der Musik des 19. Jahrhunderts, dass in fast allen europäischen Ländern dieses seelische Selbst mit der Volksmusik des Landes assoziiert wurde. Ich habe das lange nicht verstanden. Dann wurde mir klar:
Von Bach bis Mozart war Musik entweder die Musik der Kirche oder die Musik am Hof – also die Musik der privilegierten Schichten. Mit volkstümlicher Musik glaubte man nun, die Musik des Volkes, der einfachen Leute, in ihrem Wert anzuheben. Mit dem Volkstanz tritt eher die Freude an Geselligkeit und Gemeinsamkeit in den Vordergrund, statt dem Selbstbewusstsein des Individuums, das sich in den Zeiten der Revolutionen behaupten musste.
Ich vermute noch einen Aspekt und bin gespannt, ob Sie mir zustimmen: Kennen Sie das Gefühl, dass die Natur in verschiedenen Ländern jeweils eine ganz distinkte, eigene Stimmung, Atmosphäre und Faszination hat? Die Berge in Südfrankreich fühlen sich anders an als die Berge z.B. in Norwegen. Mit diesem Zauber der umgebenen Natur tritt die individuelle Seele gewissermaßen in Resonanz und lässt eingebettet darin die eigene Individualität aufblühen. Griegs musikalische Volkstümlichkeit atmet auch eine große Naturverbundenheit. Darin lebt das Gefühl von Tänzen und Festen in der Natur. Deshalb ist der volkstümliche Ton so eng mit dem Naturgefühl einer Region verbunden.
Beethoven Sonate op. 109
Ohne Rudolf-Steiner-Anhänger zu sein, finde ich sein Statement über Beethoven genial: Beethoven habe die “ich-Kräfte” gestärkt. Besser kann man es nicht formulieren, wie die mitunter titanische Willenskraft seine Klänge zu nahezu idealer Musik für das neue menschliche Selbstverständnis nach der Aufklärung macht.
In seinen späten Werken transzendiert Beethoven tatsächlich diese ich-Kraft ähnlich wie ein Mystiker und begibt sich in einen überpersönlichen Ozean himmlischen Friedens wie im 3. Satz der Sonate op. 109. Im zweiten Satz lehnen sich die titanischen ich-Kräfte Beethovens noch einmal auf, um im dritten Satz quasi zu verschwinden. Der zweite Satz hat auch etwas Diabolisches, fieberhaft Unruhiges, wie ein kurzer Ritt durch die Hölle, bevor sich die Musik quasi im blauen Ether wiederfindet.
Am Ende dieses zauberhaft ruhigen Schluss-Satzes komponiert Beethoven ein regelrecht mystisches Szenario einer Endzeit-Fantasie, in der sich nicht nur das “ich”, sondern die Formen und Strukturen der Welt aufzulösen scheinen. Die Rhythmen der Melodie werden immer mehr zerkleintert, gespalten, bis nur noch ein gleißend heller, schwindelerregend flirrender “Spiralnebel” übrig bleibt, bevor die Musik mit der Reminiszenz des Themas in tiefen Frieden sinkt – fast einen Frieden des Nichtmehr-Seins.